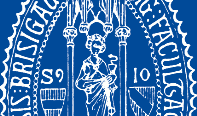Studium und Lehre
Allgemeine Informationen
Alle Lehrveranstaltungen des Lehrstuhls für Christliche Religionsphilosophie werden regulär als Präsenzveranstaltungen durchgeführt. Gegebenenfalls werden einzelne Sitzungstermine in digitaler/hybrider Form durchgeführt oder als Aufzeichnung digital zur Verfügung gestellt.
Um an den Lehrveranstaltungen teilzunehmen, beachten Sie bitte folgende Punkte:
Geben Sie bitte möglichst frühzeitig über das Campus-Management-System HISinOne einen Belegwunsch ab; falls Sie als Gasthörer/-in an einer Lehrveranstaltung teilnehmen möchten, wenden Sie sich bitte an die jeweiligen Dozenten. Sie werden dann zeitnah zur Veranstaltung zugelassen.
In den begleitenden Kursen auf der Lernplattform ILIAS finden Sie alle Informationen zum genauen Ablauf der Lehrveranstaltungen und die relevanten Lernmaterialien. Nach der Zulassung zu einer Lehrveranstaltung in HISinOne – auch falls Sie nach Beginn der Vorlesungszeit noch einen Belegwunsch abgeben haben – werden Sie automatisch über die HISinOne/ILIAS-Schnittstelle innerhalb eines Tages in den jeweiligen ILIAS-Kurs aufgenommen, sofern Sie sich bereits einmal mit Ihrem gültigen Uni-Account in ILIAS angemeldet haben.
Falls eine Lehrveranstaltung mangels Nachfrage nicht stattfinden kann, wird dies umgehend bekanntgegeben und Sie werden bei einem von Ihnen abgegebenen Belegwunsch ebenfalls benachrichtigt.
Etwaige Änderungen zu den Terminen und Räumen und die Modalitäten und Inhalte von Prüfungs- und Studienleistungen werden auf der Internetseite des Lehrstuhls für Christliche Religionsphilosophie, in HISinOne und in den ILIAS-Kursen bekanntgegeben.
Vorlesungen
Vorlesung »Platon: die frühen und mittleren Dialoge«
In Modul 5/5L als Vorlesung »Einführung in die Philosophie I/II«
Lehrimport aus dem Philosophischen Seminar
Diese Lehrveranstaltung kann in Modul 5/5L als Vorlesung »Einführung in die Philosophie I/II« belegt werden. Weiterhin können die ausgewiesenen Lehrveranstaltungen aus den vergangenen Semestern in Modul 5/5L als Vorlesung »Einführung in die Philosophie I/II« bzw. als Seminar »Einführung in die Philosophie II« angerechnet werden.
Link zum Vorlesungsverzeichnis (HISinOne)
Dozent: PD Dr. Jorge Uscatescu Barrón
Termine: Do., 18–20 Uhr c. t., HS 3042 (Kollegiengebäude III)
Kommentar:
Zu den Hauptgestalten der Geschichte der abendländischen Philosophie gehört zweifelsohne Platon. Eine Beschäftigung mit Platon kommt einer Einführung in die Philosophie und deren Grundprobleme gleich. In der vorliegenden Vorlesung kommt es darauf an, nicht nur einen Autor und seine Texte zu interpretieren, sondern auch die von Platon vorgeschlagene Ausarbeitung dieser Grundprobleme der Philosophie sowie sein neues Verständnis der Philosophie denkend nachzuvollziehen.
In den zahlreichen Frühdialogen lässt sich eine gemeinsame Frage erkennen, nämlich die Frage nach dem Wesen der Tugend; sie dient als Leitfaden, an dem sich eine Reihe von weiteren Fragen entfaltet, in denen sich die Frage nach dem Wesen von etwas immer wieder abwandelt. Die begriffliche Bestimmung der Tugend geschieht jedoch auf dem Umweg der Beantwortung der Frage nach deren Lehrbarkeit, wie sich vornehmlich im Protagoras und Menon herausarbeiten lässt. Im Durchgang durch die frühen und mittleren Dialoge (Laches, Charmides, Euthyphon usw.) sollen ferner die Begriffe der einzelnen Tugenden gewonnen, um somit die darin sich abzeichnende „Idee“ einer Gesamttugend zu rekonstruieren, die dann zur Idee des Guten im Politeia füh-ren soll. Auf diese Weise wird zugleich der Weg von einer „Ethik“ zu einer „Ontologie“ beschritten. Am Schluss steht die Erörterung der platonischen Ideenlehre als erste Gestalt der Metaphysik, wie sie in den Dialogen Phaidon und Phaidros entwickelt worden ist, sowie das Symposium, in dem das Philosophieverständnis des Platon in Form eines literarischen Meisterwerkes vorgelegt wird. Im Laufe der Vorlesung soll im Ausgang von den frühen zu den mittleren Dialogen der Weg von der Frage nach dem Wesen von etwas zur Frage nach den Ideen bzw. dem Sein nachvollzogen werden. Erst dann können Gegenstand und Begriff der platonischen Philosophie angemessen umgrenzt werden.
Vorlesung »Philosophische Anthropologie«
In Modul 6/6L
Aufgrund eines Forschungssemesters von Prof. Enders wird diese Vorlesung durchgeführt vom Lehrstuhl für Fundamentaltheologie und Philosophische Anthropologie.
Link zum Vorlesungsverzeichnis (HISinOne)
Dozent: Prof. Dr. Magnus Striet
Termine: Do., 14–16 Uhr c. t., HS 1221 (Kollegiengebäude I)
Vorlesung »Philosophische Ethik«
In Modul 12/12L
Aufgrund eines Forschungssemesters von Prof. Enders wird diese Vorlesung durchgeführt vom Lehrstuhl für Moraltheologie.
Link zum Vorlesungsverzeichnis (HISinOne)
Dozent: PD Dr. Bernhard Koch
Termine: Fr., 10–12 Uhr c. t. (am 25.4.2025 in Präsenz in HS 1016 (Kollegiengebäude I); ab 2.5.2025 online per Zoom)
Kommentar:
Die Veranstaltung führt in die Philosophische Ethik ein. Die Pluralisierung der normativen Orientierungen in der modernen Gesellschaft hat zur Folge, dass unterschiedliche „Moralen“ aufeinandertreffen und der Bedarf an einer ethischen Reflexion divergierender Vorstellungen davon, was gut und rechtens ist, dringlicher wird. Die Veranstaltung vermittelt ein Verständnis der Grundbegriffe der Moralphilosophie und der Philosophischen Ethik, stellt die Grundformen moralischer und ethischer Argumentation vor und erläutert anhand zentraler Klassiker in der Geschichte der Philosophischen Ethik unterschiedliche Konzepte der normativen Ethik. Ziel der Veranstaltung ist die Vermittlung der Fähigkeit, moralische Urteile in Bezug auf grundlegende Wertoptionen und Argumentationsmuster reflektieren zu können.
Es wird interaktive Anteile geben, um Studierenden die Möglichkeit zur eigenständigen moralischen Argumentation und ethischen Reflexion im Ausgang von aktuellen Fallbeispielen zu bieten. Grundlage der Vorlesung wird Micha H. Werners neue „Einführung in die Ethik“ sein, die vom Verlag im Open Access zur Verfügung gestellt wird.
Vorlesung »Vernunft und (religiöser) Glaube aus philosophischer Sicht: Glaube und Vernunft oder Glaube oder Vernunft? Zum Verhältnis zwischen dem christlichen (Offenbarungs-)Glauben und der natürlichen Vernunfterkenntnis des Menschen«
In Modul 19 als Vorlesung „Vernunft und (religiöser) Glaube aus philosophischer Sicht“
In MEd-M3/MEdE-M3 als Vorlesung aus dem Bereich der Systematischen Theologie
In Profilmodul II als Lehrveranstaltungen nach Wahl
Link zum Vorlesungsverzeichnis (HISinOne)
Dozent: Prof. Dr. Richard Schenk
Termine: Do., 10–12 Uhr c. t., HS 1016 (Kollegiengebäude I)
Kommentar:
Die Frage nach dem Verhältnis zwischen dem Wahrheitsanspruch des christlichen Offenbarungsglaubens und den Möglichkeiten und Grenzen der natürlichen Vernunfterkenntnis des Menschen ist im abendländisch-christlichen Kulturraum fast so alt wie der christliche Offenbarungsglaube selbst. Denn diese Frage wird bereits durch den Umstand gestellt, dass der christliche Offenbarungsglaube mit einem absoluten und universalen Geltungsanspruch auf objektive Wahrheit und Normativität insbesondere seiner zentralen Glaubensinhalte der Inkarnation, der Christologie und der Trinitätslehre auftritt, der für das autonome Erkenntnisvermögen der menschlichen Vernunft eine Herausforderung darstellt und von ihm daher in der abendländischen Geschichte des Christentums auch wiederholt einer rationalen Legitimitätsprüfung unterzogen worden ist. Die wichtigsten rationalen Gründe, die in der Geschichte dieser Verhältnisbestimmung für und gegen den Wahrheitsanspruch des christlichen Glaubens genannt worden sind, sollen in dieser Vorlesung vorgestellt und beurteilt werden.
Vorlesung »Existenz, Differenz und Geschichtlichkeit«
In Modul 19 als Vorlesung »Prinzipien philosophischer Erklärungsmodelle«
Lehrimport aus dem Philosophischen Seminar
Diese Lehrveranstaltung kann in Modul 19 als Vorlesung »Prinzipien philosophischer Erklärungsmodelle« belegt werden. Weiterhin können die ausgewiesenen Lehrveranstaltungen aus den vergangenen Semestern in Modul 19 als Vorlesung »Prinzipien philosophischer Erklärungsmodelle« angerechnet werden.
Link zum Vorlesungsverzeichnis (HISinOne)
Dozent: Prof. Dr. Philipp Schwab
Termine: Mo., 18–20 Uhr c. t., HS 1199 (Kollegiengebäude I)
Tutorat: Do., 12–14 Uhr c. t., HS 1231 (Kollegiengebäude I)
Seminare
Interdisziplinäres Seminar »Glaube als Daseinsvollzug. Das gestufte Glaubensverständnis und das Verhältnis zwischen Glaube und Vernunft im religionsphilosophischen Denken Bernhard Weltes«
In Modul 19 als religionsphilosophisches Seminar des Sommersemesters
In Modul 15/23, Modul 15La/b/c, Profilmodul I, MEd-M3, MEd-M4 und MEdE-M3 als interdisziplinäres Hauptseminar
In Modul 15/23 und Profilmodul II als Lehrveranstaltung nach Wahl
Link zum Vorlesungsverzeichnis (HISinOne)
Dozenten:
- Dipl.-Theol. Frank Schlesinger
- Dr. Dr. Boris Wandruszka
Termine: Do., 14–16 Uhr c. t., HS 1140 (Kollegiengebäude I)
Kommentar:
In diesem interdisziplinären Seminar soll das gestufte Glaubensverständnis und das Verhältnis zwischen philosophischem und religiösem, insb. christlichem Denken im religionsphilosophischen Denken des Freiburger Religionsphilosophen Bernhard Welte (1906–1983) behandelt werden. Dabei soll zunächst anhand von Weltes Schrift Was ist Glauben? gezeigt werden, inwiefern das menschliche Dasein bereits in seinem natürlichen Selbstvollzug einen dieses Dasein begründenden Glauben besitzt, der einen für Welte implizit religiösen Charakter besitzt. Sodann soll der interpersonale, mitmenschliche Charakter dieses daseinsmäßigen Glaubens aufgewiesen und in einem weiteren Schritt dessen Verhältnis zu dem ausdrücklich religiösen, insbesondere christlichen Glauben an Gott und dessen Offenbarung zum Heil des Menschen bestimmt werden. In einem zweiten Teil des Seminars soll ausgehend von Weltes erstem Hauptwerk Heilsverständnis seine Deutung des Seinsverständnisses des menschlichen Daseins als eines Heilsverständnisses und dessen nähere Bestimmung (dessen Prinzip und dessen Modus) sowie dessen Verhältnis zur faktischen Heilsdifferenz des menschlichen Daseins in Schuld und Tod aufgezeigt werden. Schließlich soll der antizipatorische Charakter des menschlichen Heilsverständnisses als eines Vor-Verständnisses und dessen leitende Bestimmung als Konvenienz, d. h. als Angemessenheit einer möglichen Heilsgabe zu der eigenen heilsdifferenten Faktizität des menschlichen Daseins, sichtbar gemacht werden. Diese Konvenienz erläutert Welte mit dem Gedanken der »unbedingten Konkretion«: dass in einer einzigen, konkreten Person das ganze von jedem menschlichen Da-sein ersehnte Heil vollkommen gegenwärtig und zugänglich ist. Abschließend wird noch auf das Verständnis des Glaubens in Weltes späterem Hauptwerk, seiner Religionsphilosophie, eingegangen.
Seminar »Si Deus est, unde malum? Das Theodizeeproblem als logisches Widerspruchsproblem aus philosophischer Sicht«
In Modul 5/5L als Seminar »Einführung in die Philosophie II«
In Modul 15/23, Modul 15La/b/c, Profilmodul I, MEd-M3, MEd-M4 und MEdE-M3 als interdisziplinäres Hauptseminar
In Modul 15/23 und Profilmodul II als Lehrveranstaltung nach Wahl
Link zum Vorlesungsverzeichnis (HISinOne)
Dozenten: Dipl.-Theol. Frank Schlesinger
Termine: Mi., 14-16 Uhr c.t., R 1336-38 (Kollegiengebäude I)
Kommentar:
Die Erfahrung von Leid und Übel gehört zu den größten Herausforderungen für den Glauben an einen allmächtigen, allwissenden und vollkommen guten Gott. In klassischer Weise hat Laktanz diese Herausforderung, die seit Leibniz als Theodizeeproblem bezeichnet wird, als vermeintliche Formulierung Epikurs überliefert:
„Entweder will Gott die Übel beseitigen und kann es nicht, oder er kann es und will es nicht, oder er kann es nicht und will es nicht, oder er kann es und will es. Wenn er nun will und nicht kann, so ist er schwach, was auf Gott nicht zutrifft. Wenn er kann und nicht will, dann ist er missgünstig, was ebenfalls Gott fremd ist. Wenn er nicht will und nicht kann, dann ist er sowohl missgünstig als auch schwach und dann auch nicht Gott. Wenn er aber will und kann, was allein sich für Gott ziemt, woher kommen dann die Übel und warum nimmt er sie nicht weg?“ (Laktanz, De ira dei 13,20 f.)
Dieses Seminar will anhand ausgewählter Autoren von der Antike bis zur Gegenwart (z. B. Laktanz, Augustinus, Thomas v. Aquin, Leibniz, Kant, Barth, Jonas, Metz, Plantinga, Swinburne, Hermanni) in das Theodizeeproblem einführen und die Fragestellung sowie die verwendeten Prämissen und Argumente philosophisch systematisieren. Dabei sollen sowohl Positionen, die gegen die Lösbarkeit des Theodizeeproblems argumentieren, als auch die sachlich wichtigsten philosophischen Argumente für die Rationalität des Theismus gegen die Behauptung seiner Irrationalität und Widersprüchlichkeit angesichts des Leids und Übels in der Welt untersucht und bewertet werden.
Absolvierung von Modul 5/5L
Einführung in philosophische Grundfragen der Theologie
Studierende der Magisterstudiengänge Katholische Theologie und des Bachelorstudiengangs Katholische Theologie (Hauptfach) müssen zur erfolgreichen Absolvierung von Modul 5 zusätzlich zur Vorlesung »Einführung in die Religionsphilosophie« die Vorlesung »Einführung in die Philosophie I« und die Vorlesung »Einführung in die Philosophie II« oder das Seminar »Einführung in die Philosophie II« belegen; im Rahmen dieses Seminars ist dann zusätzlich eine Studienleistung zu erbringen.
Studierende des Polyvalenten Zwei-Hautfächer-Bachelorstudiengangs Katholische Theologie und des Studiengangs Master of Education Erweiterungsfach Katholische Theologie (120 ECTS) müssen zur erfolgreichen Absolvierung von Modul 5L zusätzlich zur Vorlesung »Einführung in die Religionsphilosophie« die Vorlesung »Einführung in die Philosophie I« oder die Vorlesung »Einführung in die Philosophie II« oder das Seminar »Einführung in die Philosophie II« belegen; im Rahmen dieses Seminars ist dann zusätzlich eine Studienleistung zu erbringen.
Für die mündliche Modulprüfung (15 Minuten) in Modul 5/5L wurden folgende Prüfungsinhalte festgelegt:
- Für Studierende der Magisterstudiengänge Katholische Theologie und des Bachelorstudiengangs Katholische Theologie (Hauptfach): die Inhalte der Vorlesung »Einführung in die Religionsphilosophie« und jeweils drei Schwerpunktthemen aus der Vorlesung »Einführung in die Philosophie I« und der Vorlesung »Einführung in die Philosophie II« oder dem Seminar »Einführung in die Philosophie II«
- Für Studierende des Polyvalenten Zwei-Hautfächer-Bachelorstudiengangs Katholische Theologie und des Studiengangs Master of Education Erweiterungsfach Katholische Theologie (120 ECTS): die Inhalte der Vorlesung »Einführung in die Religionsphilosophie« und drei Schwerpunktthemen aus der Vorlesung »Einführung in die Philosophie I« oder der Vorlesung »Einführung in die Philosophie II« oder dem Seminar »Einführung in die Philosophie II«
Bitte tragen Sie die Wahl Ihrer Schwerpunktthemen spätestens eine Woche vor dem Prüfungstermin in den Buchungspools im ILIAS-Kurs der Vorlesung »Einführung in die Religionsphilosophie« ein und melden Sie die Prüfungsleistung rechtzeitig beim Prüfungsamt an.
Absolvierung von Modul 19
Spezialisierung im Bereich der Fundamentaltheologie und der Philosophie
Zur erfolgreichen Absolvierung von Modul 19 muss zusätzlich zur Vorlesung »Vernunft und (religiöser) Glaube aus philosophischer Sicht« das parallel dazu angebotene religionsphilosophische Seminar des Sommersemesters und die philosophische Vorlesung »Prinzipien philosophischer Erklärungsmodelle« des Wintersemesters belegt werden; letztere kann durch ein ausgewiesenes Seminar ersetzt werden.
Für die mündliche Prüfung in Modu 19 im Modulteil »Philosophie/Religionsphilosophie« wurden folgende Prüfungsinhalte festgelegt: die Inhalte der Vorlesung »Vernunft und (religiöser) Glaube aus philosophischer Sicht« und jeweils zwei Schwerpunktthemen aus dem religionsphilosophischen Seminar des Sommersemesters und der philosophischen Vorlesung »Prinzipien philosophischer Erklärungsmodelle« des Wintersemesters bzw. dem Seminar, das die Vorlesung »Prinzipien philosophischer Erklärungsmodelle« ersetzt. Bitte tragen Sie die Wahl Ihrer Schwerpunktthemen für die Prüfung spätestens eine Woche vor dem Prüfungstermin in den Buchungspools im ILIAS-Kurs der Vorlesung »Vernunft und (religiöser) Glaube aus philosophischer Sicht« ein und melden Sie die Prüfungsleistung rechtzeitig beim Prüfungsamt an.
Als Studienleistung in Modul 19 im Modulteil »Philosophie/Religionsphilosophie« für die Studierenden, die ihre Prüfung in im Modulteil »Fundamentaltheologie« ablegen, wurde ein Lernportfolio im Umfang von 12.000–14.000 Zeichen zu allen drei Lehrveranstaltungen des Modulteils (der Vorlesung »Vernunft und (religiöser) Glaube aus philosophischer Sicht«, dem religionsphilosophischen Seminar des Sommersemesters und der philosophischen Vorlesung »Prinzipien philosophischer Erklärungsmodelle« des Wintersemesters bzw. dem Seminar, das die Vorlesung »Prinzipien philosophischer Erklärungsmodelle« ersetzt) mit der schriftlichen Dokumentation der wichtigsten Lernergebnisse/-erkenntnisse und mit im Umfang möglichst gleicher Berücksichtigung aller drei Lehrveranstaltungen (jeweils ca. 4.500 Zeichen) festgelegt. Bitte laden Sie Ihr Lernportfolio bis zum 30.9. (im Sommersemester) bzw. bis zum 31.3. (im Wintersemester) im ILIAS-Kurs der Vorlesung »Vernunft und (religiöser) Glaube aus philosophischer Sicht« hoch und melden Sie die Studienleistung rechtzeitig beim Prüfungsamt an.