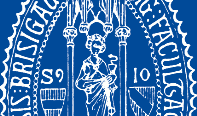Seminare
Interdisziplinäres Seminar »Glaube als Daseinsvollzug. Das gestufte Glaubensverständnis und das Verhältnis zwischen Glaube und Vernunft im religionsphilosophischen Denken Bernhard Weltes«
In Modul 19 als religionsphilosophisches Seminar des Sommersemesters
In Modul 15/23, Modul 15La/b/c, Profilmodul I, MEd-M3, MEd-M4 und MEdE-M3 als interdisziplinäres Hauptseminar
In Modul 15/23 und Profilmodul II als Lehrveranstaltung nach Wahl
Link zum Vorlesungsverzeichnis (HISinOne)
Dozenten:
- Dipl.-Theol. Frank Schlesinger
- Dr. Dr. Boris Wandruszka
Termine: Do., 14–16 Uhr c. t., HS 1140 (Kollegiengebäude I)
Kommentar:
In diesem interdisziplinären Seminar soll das gestufte Glaubensverständnis und das Verhältnis zwischen philosophischem und religiösem, insb. christlichem Denken im religionsphilosophischen Denken des Freiburger Religionsphilosophen Bernhard Welte (1906–1983) behandelt werden. Dabei soll zunächst anhand von Weltes Schrift Was ist Glauben? gezeigt werden, inwiefern das menschliche Dasein bereits in seinem natürlichen Selbstvollzug einen dieses Dasein begründenden Glauben besitzt, der einen für Welte implizit religiösen Charakter besitzt. Sodann soll der interpersonale, mitmenschliche Charakter dieses daseinsmäßigen Glaubens aufgewiesen und in einem weiteren Schritt dessen Verhältnis zu dem ausdrücklich religiösen, insbesondere christlichen Glauben an Gott und dessen Offenbarung zum Heil des Menschen bestimmt werden. In einem zweiten Teil des Seminars soll ausgehend von Weltes erstem Hauptwerk Heilsverständnis seine Deutung des Seinsverständnisses des menschlichen Daseins als eines Heilsverständnisses und dessen nähere Bestimmung (dessen Prinzip und dessen Modus) sowie dessen Verhältnis zur faktischen Heilsdifferenz des menschlichen Daseins in Schuld und Tod aufgezeigt werden. Schließlich soll der antizipatorische Charakter des menschlichen Heilsverständnisses als eines Vor-Verständnisses und dessen leitende Bestimmung als Konvenienz, d. h. als Angemessenheit einer möglichen Heilsgabe zu der eigenen heilsdifferenten Faktizität des menschlichen Daseins, sichtbar gemacht werden. Diese Konvenienz erläutert Welte mit dem Gedanken der »unbedingten Konkretion«: dass in einer einzigen, konkreten Person das ganze von jedem menschlichen Da-sein ersehnte Heil vollkommen gegenwärtig und zugänglich ist. Abschließend wird noch auf das Verständnis des Glaubens in Weltes späterem Hauptwerk, seiner Religionsphilosophie, eingegangen.
Seminar »Si Deus est, unde malum? Das Theodizeeproblem als logisches Widerspruchsproblem aus philosophischer Sicht«
In Modul 5/5L als Seminar »Einführung in die Philosophie II«
In Modul 15/23, Modul 15La/b/c, Profilmodul I, MEd-M3, MEd-M4 und MEdE-M3 als interdisziplinäres Hauptseminar
In Modul 15/23 und Profilmodul II als Lehrveranstaltung nach Wahl
Link zum Vorlesungsverzeichnis (HISinOne)
Dozenten: Dipl.-Theol. Frank Schlesinger
Termine: Mi., 14-16 Uhr c.t., R 1336-38 (Kollegiengebäude I)
Kommentar:
Die Erfahrung von Leid und Übel gehört zu den größten Herausforderungen für den Glauben an einen allmächtigen, allwissenden und vollkommen guten Gott. In klassischer Weise hat Laktanz diese Herausforderung, die seit Leibniz als Theodizeeproblem bezeichnet wird, als vermeintliche Formulierung Epikurs überliefert:
„Entweder will Gott die Übel beseitigen und kann es nicht, oder er kann es und will es nicht, oder er kann es nicht und will es nicht, oder er kann es und will es. Wenn er nun will und nicht kann, so ist er schwach, was auf Gott nicht zutrifft. Wenn er kann und nicht will, dann ist er missgünstig, was ebenfalls Gott fremd ist. Wenn er nicht will und nicht kann, dann ist er sowohl missgünstig als auch schwach und dann auch nicht Gott. Wenn er aber will und kann, was allein sich für Gott ziemt, woher kommen dann die Übel und warum nimmt er sie nicht weg?“ (Laktanz, De ira dei 13,20 f.)
Dieses Seminar will anhand ausgewählter Autoren von der Antike bis zur Gegenwart (z. B. Laktanz, Augustinus, Thomas v. Aquin, Leibniz, Kant, Barth, Jonas, Metz, Plantinga, Swinburne, Hermanni) in das Theodizeeproblem einführen und die Fragestellung sowie die verwendeten Prämissen und Argumente philosophisch systematisieren. Dabei sollen sowohl Positionen, die gegen die Lösbarkeit des Theodizeeproblems argumentieren, als auch die sachlich wichtigsten philosophischen Argumente für die Rationalität des Theismus gegen die Behauptung seiner Irrationalität und Widersprüchlichkeit angesichts des Leids und Übels in der Welt untersucht und bewertet werden.